
Tenniskampioenschappen Nederland, Tom Okker (l) en Jan Hajer (r) .*16 augustus 1964 Foto: Eric Koch für Anefo unter 1.0 Verzicht auf das Copyright
Dieser Tage ist ein Eau de Toilette auf den Markt gekommen, dass angeblich nach Fußball riecht, nach der Bundesliga. Das ist natürlich Quatsch. Fußball riecht nicht mehr. Fast alle Sportarten haben ihren Geruch verloren.
Als ich anfing, Sport zu treiben, damals, in de 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. hatte Sport noch einen unverwechselbaren, unvergesslichen Geruch. Sport roch damals wie ein Geschäft namens „Sport-Beyer“ in meiner Heimatstadt Eschwege, in der Marktstraße.
„Sport-Beyer“ war damals der Fixpunkt eines jeden Sport treibenden Menschen in Eschwege und Umgebung. Dort kaufte man die Ausrüstung und die Klamotten. Meine ersten Fußballschuhe (Adidas „Uwe Seeler“, welche denn sonst?), den ersten Fußball aus Leder, den ersten Tennisschläger (Dunlop Maxply), den Tischtennisschläger, den auch Eberhard Schöler benutzte, ein bis zwei Paar Tennisschuhe (Romika) pro Saison, regelmäßig neue Tennisbälle, regelmäßig neue Sportschuhe für die Turnhalle, den letzten Tennisschläger, den mein Vater mir gekauft hat (Wilson T20001), später dann alle 3 bis 6 Monate neue Basketballschuhe, und natürlich Trainingsanzüge, Sportklamotten ohne Ende … ja, all das und wohl noch viel mehr hab ich aus dem Ladengeschäft in der Marktstraße getragen. Meine Sportbegeisterung und ich waren meinen Eltern lieb und teuer.
Und jedes Mal, wenn ich bei Sport-Beyer vorbeischaute, hat mich der Geruch umgehauen, der einen ansprang, wenn man die Ladentür aufgemacht hat. Ein ganz eigene, kraftvolle Kombination aus Leder, Baumwolle, Gummi, Zelluloid, Filz, Holz … Damals waren Sportgeräte noch nicht aus olfaktorisch neutralem Kunststoff, sie rochen deutlich nach den Materialien, aus denen sie hergestellt worden waren. Und diese Geruchsmischung gab’s nur in dezidierten Sportgeschäften, weil sich nur hier die Gerüche aller Sportarten in einzigartiger Weise vermischten. Wobei eine Komponente – natürlich – fehlte: In Sportgeschäften roch es niemals nach Schweiß. Diese markante Duftnote musste man selber hinzufügen, auf dem Platz oder in der Halle. Sportgeschäfte verkauften auch vom Geruch her die reine Verheißung. Die Mühen der Ebene begannen, wenn Herrn Beyers Registrierkasse geklingelt hatte.
Sport-Beyer gibt’s schon lange nicht mehr, und dieser Geruch, der damals fast allen Sportgeschäften zu eigen war, ist auch verschwunden. Das ist auch ganz gut so, denn die modernen Sportgeräte und -klamotten aus Kunststoff sind deutlich praktischer und viel einfacher zu handhaben, als das Zeugs, mit dem unsereins sich damals rumgeschlagen hat. Der Geruch allerdings… ja, der war schon ziemlich speziell und angenehm. Unvergesslich. Doch, das war eine schöne Zeit, als Sport noch gerochen hat.
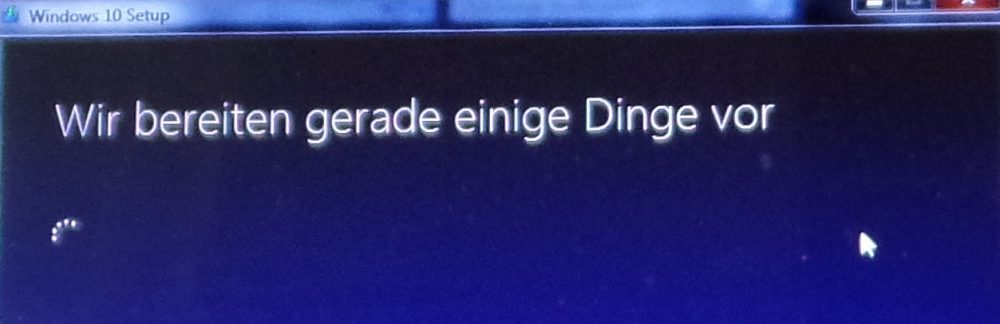


 Das Leibgericht meines aus Ostpreußen stammenden Vaters wurde in unserer Familie nur „Knödel“ genannt. Es handelte sich um mit gekochtem Rindfleisch angereicherte, flache Kartoffelknödel aus rohen und gekochten Kartoffeln, „halb und halb“, wie man sagt. Merkwürdigerweise steht dieses Gericht in keinem der mir bekannten ostpreußischen Kochbücher, und auch in der Ostpreußen-Ecke des Internet konnte ich es nicht auftreiben. Dort finden sich nur „Königsberger Keilchen“ bzw. „Knödel aus Goldap“, beides mit „Halb und Halb“-Knödeln, jedoch mit gebratenem Schweinefleisch, das separat dazu gereicht wird. Im Raum Salzburg findet sich jedoch ein Gericht namens „Restl-Knödel“, das „unseren“ Knödeln ähnelt, jedoch auf Semmelknödel-Basis zubereitet wird. Im 18. Jahrhundert kam eine größere Zahl
Das Leibgericht meines aus Ostpreußen stammenden Vaters wurde in unserer Familie nur „Knödel“ genannt. Es handelte sich um mit gekochtem Rindfleisch angereicherte, flache Kartoffelknödel aus rohen und gekochten Kartoffeln, „halb und halb“, wie man sagt. Merkwürdigerweise steht dieses Gericht in keinem der mir bekannten ostpreußischen Kochbücher, und auch in der Ostpreußen-Ecke des Internet konnte ich es nicht auftreiben. Dort finden sich nur „Königsberger Keilchen“ bzw. „Knödel aus Goldap“, beides mit „Halb und Halb“-Knödeln, jedoch mit gebratenem Schweinefleisch, das separat dazu gereicht wird. Im Raum Salzburg findet sich jedoch ein Gericht namens „Restl-Knödel“, das „unseren“ Knödeln ähnelt, jedoch auf Semmelknödel-Basis zubereitet wird. Im 18. Jahrhundert kam eine größere Zahl 

 Dieser Auflauf war das Lieblingsessen meiner Kindheit und Jugend. Den wünschte ich mir immer als Geburtstagsessen, und auch zwischen den Geburtstagen kam er öfters auf den Tisch. Gleichzeitig ist er typisch für die Küche meiner Mutter: relativ wenige Zutaten, aber immer ein, zwei Gewürze dabei, die für einen interessanten Geschmack sorgen. Und: Raffinesse nebst Sorgfalt bei der Zubereitung. Wer hier aus Bequemlichkeit schummelt und zum Beispiel das Anbraten des Reises (spielentscheidend!) weglässt, raubt dem Gericht seinen Charakter. Aber der Reihe nach, zuerst die Zutaten (für eine Auflaufform, vier bis sechs Personen, drei wenn ich mitesse):
Dieser Auflauf war das Lieblingsessen meiner Kindheit und Jugend. Den wünschte ich mir immer als Geburtstagsessen, und auch zwischen den Geburtstagen kam er öfters auf den Tisch. Gleichzeitig ist er typisch für die Küche meiner Mutter: relativ wenige Zutaten, aber immer ein, zwei Gewürze dabei, die für einen interessanten Geschmack sorgen. Und: Raffinesse nebst Sorgfalt bei der Zubereitung. Wer hier aus Bequemlichkeit schummelt und zum Beispiel das Anbraten des Reises (spielentscheidend!) weglässt, raubt dem Gericht seinen Charakter. Aber der Reihe nach, zuerst die Zutaten (für eine Auflaufform, vier bis sechs Personen, drei wenn ich mitesse): Leider bin ich, bis ich mit 18 Jahren auszog, daran gescheitert, meine Mutter davon zu überzeugen, den Reisauflauf einen Tag vor meinem Geburtstag auf den Tisch zu bringen, damit ich als eigentliches Geburtstagsessen die aufgebratenen Reste genießen konnte. Auf meine fundierten, wohl abgewogenen Argumente antwortete sie, wie so oft, nur mit hochgezogenen Augenbrauen bzw. einem unverständlichen Gemurmel, das sich in etwa wie „Geburtstagsessen einen Tag früher, das könnte dir so passen.“ anhörte. Tja.
Leider bin ich, bis ich mit 18 Jahren auszog, daran gescheitert, meine Mutter davon zu überzeugen, den Reisauflauf einen Tag vor meinem Geburtstag auf den Tisch zu bringen, damit ich als eigentliches Geburtstagsessen die aufgebratenen Reste genießen konnte. Auf meine fundierten, wohl abgewogenen Argumente antwortete sie, wie so oft, nur mit hochgezogenen Augenbrauen bzw. einem unverständlichen Gemurmel, das sich in etwa wie „Geburtstagsessen einen Tag früher, das könnte dir so passen.“ anhörte. Tja.