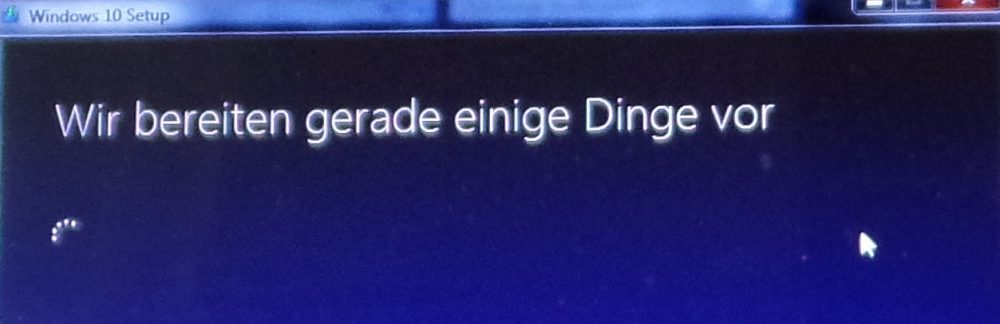… habe ich genossen, als ich sie noch gar nicht würdigen konnte. Ich war schlanke1 17 Jahre alt, als unser tollkühner Klassenlehrer uns in zwei VW-Busse packte, um mit uns 14 unvergessliche Tage lang den Süden Frankreichs zu erkunden. Tarrascon, Arcachon, die Camarque … plötzlich wurde der Horizont auch für den engstirnigsten Nordhessen wunderbar weit. Auch, was das Essen anbelangt, denn das, was in Frankreich auf die Teller kam, war tatsächlich Lichtjahre von dem entfernt, was im Kreis Eschwege aufgetischt wurde. Einige meiner Klassenkameraden sehnten sich bald nach Bratwurst und Krautshäuptchen zurück, aber bei mir begann die lebenslange Liebesgeschichte mit der französischen Küche in diesen Tagen. Genauer gesagt, an einem der letzten Tage unserer Klassenfahrt, an denen unsere VW-Busse und Zelte auf dem Campingplatz „Les cent chênes“ in St. Jeannet standen, nur wenige Kilometer von Nizza entfernt. Auf dem Campingplatz gab es zwar eine Bar mit jeder Menge leckerer Getränke, aber kein Restaurant. Man konnte allerdings eine Bouillabaisse bekommen, wenn man sie drei Tage im Voraus bestellte. Diese Bouillabaisse wurde von Madame Oddo zubereitet, der Chefin der Campingplatz-Betreiber-Familie, einer Matriarchin von beeindruckender Autorität. Am Tag nach der Vorbestellung schwärmten die Familienmitglieder zu den Fischern der Umgebung aus und bestellten die Fische für die Suppe vor. „Dans ma bouillabaisse, il y a chaque poisson de la Méditerranée.“ war das Credo von Madame Oddo, und am Tag des Bouillabaisse-Essens schwärmten die Familienmitglieder erneut aus und holten die bestellten, am selben Morgen gefangenen Fische ab.
Am Abend wurde aufgetischt. Auf der großen Wiese hatten die Oddos eine lange Tafel aufgebaut, an der wir Platz nehmen durften. Dann wurden Platten mit den im ganzen gekochten Fischen aufgetragen, Terrinen mit dem Sud, in dem sie gegart worden waren und Schalen mit einer scharfen, knoblauchlastigen Paste, die verwirrenderweise so hieß wie mein Schulfreund Rudi, dessen Namen wir mit stimmlosem „d“ auszusprechen pflegten. Dazu noch jede Menge knuspriges Baguette vom Bäcker in St. Jeannet, das kannten wir schon.
Von den Fischen, die da auf den Platten vor uns lagen, kannte ich keinen einzigen, die waren im Biologie-Unterricht von Dr. Zöll nicht vorgekommen. Auch vom Entgräten von Fischen hatte ich keine Ahnung, aber was machte das schon? Neuland war damals noch dazu da, betreten zu werden, ich zerfetzte zwei Fische, kippte mir Suppe und Rouille drauf, trank mir mit etwas Weißwein Mut an und legte los.
Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Eher im Gegenteil. Dafür hatte ich zu viele Gräten im Fischfleisch übersehen, dafür war der safranisch-fenchelige Geschmack der Suppe zunächst zu fremdartig, die Rouille für meinen noch ungestählten Gaumen zu scharf. Aber es schmeckte nur ungewohnt, nicht schlecht. Weißwein half. Und als ich meinen Teller geleert hatte, zerfetzte ich zwei weitere Fische und begann, mich wohl zu fühlen. Sehr wohl zu fühlen. Mir war klar, dass dieses wunderbare Essen mit meinen Klassenkameraden und meinem Lehrer auf der Lichtung im Eichenwald, unter dem blauen Himmel der Cote d’Azure, eine der Mahlzeiten war, die ich niemals vergessen würde. Was konnte es schöneres geben, als mit Freunden im Schatten französischer Eichen Bouillabaisse zu essen, umgeben von Knoblauchduft und goldener Zukunft?
Heute weiß ich, dass das allein schon wegen der Frische und der Vielfalt der verwendeten Fische eine absolut sensationelle Bouillabaisse gewesen sein muss. Ich würde einiges geben, sie noch einmal kosten zu dürfen. Oder doch lieber nicht. So gut, wie sie in meiner Vorstellung mittlerweile ist, kann sie ja gar nicht gewesen sein. Oder … vielleicht doch?