„Georges! Noch ein trou normande, s’il vous plait! Von irgendwas muss dieses verdammte Sodbrennen doch weggehen.“
Noch ein gieriger Zug aus der Gitanes, und in einem energischen Schwung drückt er sie aus und zündet die nächste an, nimmt einen Schluck des mittlerweile zu warmen Weißweins, ungeduldig auf das „trou normande“ wartend.
„Wenn du wenigstens nicht mehr zwischen den Gängen rauchen würdest…“
Ihre geschwungenen Augenbrauen krümmen sich, als würde sie das Sodbrennen empfinden, das ihm gerade zu schaffen machte.
„Suzanne, sei kein Spielverderber. Heute wird gefeiert! Ah, Georges, endlich, das trou normande! Nur ein trou normande kann mir die Kraft verleihen, den Hauptgang durchzustehen.“
„Selbstverständlich, Monsieur.“
Er stürzt den Calvados herunter, leckt sich die Lippen, dass ihm kein Tropfen des Leib und Seele wärmenden Apfelschnapses entgeht, lehnt sich zurück und zieht an der Zigarette.
„Gibst du mir einen Zug von deiner Zigarette, Cherie?“
„Aber du rauchst doch nicht, Suzanne. Du hast vor Jahren aufgehört…“
„Jeder Zug, den du nicht machst, verlängert dein Leben.“
„Suzanne, ich bitte dich, hör doch wenigstens an diesem Abend mit deinen Predigten auf.“
„Es sind keine Predigten. Nach zwei Herzinfarkten…“
„Suzanne! Wenn ein kleiner, dahergelaufener Jazz-Kritiker es geschafft hat, einen Bestseller über einen mittlerweile ziemlich obskuren Gitarristen zu schreiben, der zu seinen Lebzeiten soviel Schallplatten verkauft hat wie Puff Daddy montags vor dem Frühstück, darf man schon mal ein bißchen über die Stränge schlagen!“
„Cherie, du sollst doch über die Stränge schlagen. Ich will doch, daß du über die Stränge schlägst. Aber du sollst auch morgen noch über die Stänge schlagen. Bei deinem letzten Infarkt warst du klinisch tot, 3 Minuten lang.“
„Der Tod wird überschätzt. Ich spreche aus Erfahrung.“
„Das ist nicht komisch.“
„Doch, das ist sogar sehr komisch. Ich muss das schließlich wissen. Ich war tot, und du nicht.“
Ungeduldig hält er nach Georges Ausschau, sieht ihn am anderen Ende des Saales, will nicht warten, gießt den Rest des Chablis selber ein und kleckert dabei mit Schwung, wie immer, auf die Tischdecke.
„Suzanne, ich will damit sagen, ich war gar nicht tot.“
„Die Ärzte sagen aber etwas ganz anderes. Und die ganzen Bücher, die ich gelesen habe…“
„Die auf deinem Nachtisch liegen? Dieses Zeugs über Nahtod-Erfahrungen?“
„Ich versuche nur, zu verstehen, was dir geschehen ist.“
„Begreif doch endlich, mir ist nichts dergleichen geschehen. Ich habe diese Bücher auch gelesen, und nichts, was da drin steht, diese ganzen Geschichten mit einer Tür, die sich öffnet, die zu einem unglaublich hellen Licht führt, dieses unglaubliche Glücksgefühl… das alles gab es bei mir nicht, ich kann nicht tot gewesen sein.“
„Ach, du negierst nur wieder…“
„Ich negiere nicht, was diese Leute erlebt haben, im Gegenteil, ich glaube daran. Ich glaube nur nicht, dass
mir das widerfahren ist. Oder in naher Zukunft widerfahren wird.“
„Wieso wird dir das nicht widerfahren? Bist du unsterblich geworden, weil du seit heute die Bestseller-Liste anführst?“
„Aber nein. Ich kann nicht sterben, bevor du nicht stirbst.“
„Sei nicht albern.“
„Ich bin nicht albern, ich bin todernst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann nicht sterben, so lange du lebst.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Alle Menschen mit Nahtod-Erfahrungen berichten, dass sie bei ihrem Tod von einem Menschen sozusagen abgeholt worden sind. Dass sie von dem Menschen über die Schwelle ins Jenseits gebracht wurden, den sie am meisten geliebt haben, der ihnen in ihrem Leben am meisten bedeutet hat.“
„Und?“
„Aber, Suzanne, versteh doch, in meinem Leben bist du dieser Mensch. Niemand bedeutet mir mehr als du, ich liebe niemanden mehr als dich. Niemand anderes als du wird mich jemals über die Schwelle des Todes führen können! Und deshalb habe ich auch nichts gespürt, als ich angeblich tot war. Weil ich nicht sterben konnte, weil niemand da war, um mich über diese Schwelle zu führen.“
„Das ist idiotisch.“
„Solange du lebst, bin ich unsterblich.“
„Das ist morbide.“
„Aber nein, im Gegenteil. In meinem Fall ist das lebensbejahend.“
Endlich, endlich hat er es geschafft. Suzanne kann ein Lächeln nicht mehr unterdrücken, muss lachen, wegen seiner Frechheit, seinem immer noch jungenhaftem Charme, dem piratenhaften Glauben an die eigene Unzerstörbarkeit, mit dem er jeden Tag das Leben angeht. Endlich wirft Suzanne wieder einmal ihr Haar zurück, lässt das Lachen tief aus ihrer Kehle
herausperlen, greift zum Glas, stößt mit ihm an, und schaut ihm tief in die Augen, während sie einen Schluck nimmt.
Und er will etwas sagen, noch einen draufsetzen, doch er verspürt einen Luftzug. Als hätte sich eine Tür geöffnet, und richtig, jemand ist herein gekommen, ein Straßenmusiker steht plötzlich neben ihrem Tisch, ein südländischer Typ, zurückgeklatschte Haare, Menjou-Bart. An einem abgewetzten Ledergurt hängt ihm eine Selmer-Maccaferri über die Schulter, er greift in ihre Saiten und beginnt zu spielen.
„Douce Ambiance“. Das darf nicht sein. Das Lied gehört dem Manouche, das ist ein geschmackloser Zufall, ausgerechnet dieser Abend darf nicht durch einen profanen Stümper entweiht werden, der „Douce Ambiance“ zerstört, und er will ihm Einhalt gebieten, aber die Musik zwingt ihn zuzuhören. Die Musik ist gut, der Stümper ist gut, der Stümper ist besser als gut, der Stümper ist kein Stümper, der Stümper ist fast so gut wie der Manouche, und natürlich ist das kein Zufall, natürlich hat Suzanne das organisiert, der Stümper ist kein Straßenmusiker, der Stümper ist ein Genie, das Suzanne engagiert hat, um diesem Abend die Krone aufzusetzen, oh, wundervolle Suzanne, oh, wundervoller Abend, oh, wundervolles Leben, oh, unglaubliches Glück, oh, „Douce Ambiance!“
Und plötzlich, während einer dieser einmaligen Akkord-Kaskaden, sieht er die Griffhand dieses Gitarristen, und er sieht die verbrannte Haut, die verkrüppelten Finger, der Ringfinger und der kleine Finger, nach innen verdreht, und das kann nicht sein, das ist 1928 passiert, als die brennenden Zelluloid-Blumen den Wohnwagen in ein Inferno verwandelt hatten, und er sieht sich um, und plötzlich sieht er sich selbst auf dem Fußboden des Restaurants liegen, den Mund weit offen, als wolle er alle Luft dieser Welt einsaugen und könnte es doch nicht, und Suzanne sitzt rittlings auf ihm und schlägt immer wieder mit beiden Fäusten auf seine Brust und Georges steht neben ihr und schreit in ein Telefon hinein, aber er hört nicht, was Georges schreit, er hört nur „Douce Ambiance“, dieses einmalige, für die Ewigkeit gespielte „Douce Ambiance“, dieses „Douce Ambiance“, das nur einer so spielen konnte, und da ist plötzlich die große Tür aufgeflogen, die in diesen unglaublich hellen Raum führt, und neben dieser Tür steht Django, der Manouche, mit der Selmer-Maccaferri 704 und spielt „Douce Ambiance“. Und Django lächelt.
Und Django winkt.
„Django winkt“ ist eine Kurzgeschichte, die ich vor ein paar Jahren für die Anthologie „Wendepunkte“ geschrieben habe. Heute wäre Django Reinhardt 100 Jahre alt geworden.
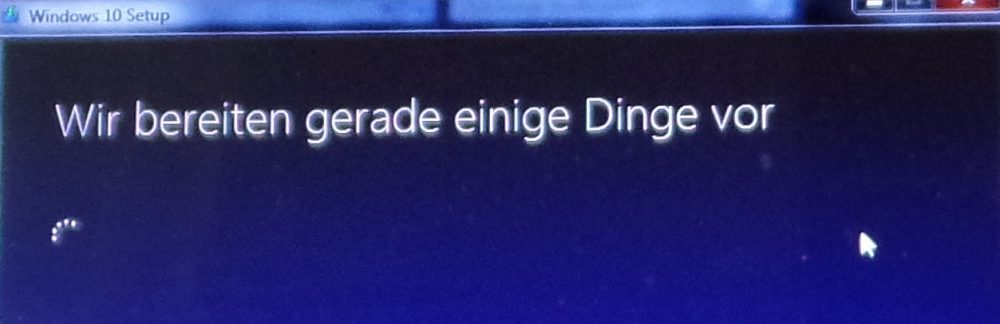
Atemberaubend erzählt.
Gerade bringt das BR 3 alpha die Django Reinhardt Group. Martin Taylor spielt auf seiner Jazz-Gitarre ein Ballade, die mir grippenkrank Frierenden eine wenig Wärme einflößt.