
Foto: cyclonebill from Copenhagen, Denmark, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Wer sich für gute Küche interessiert, gerät früher oder später an das berühmte „Filet Wellington„, einen Klassiker der feinen Küche, der seit Jahrzehnten auf den Speisekarten der gehobenen Gastronomie zu finden ist. Was einigermaßen erstaunlich ist, denn von der Rezeptur her ist das Wellington kein Musterbeispiel für kulinarische Logik. Hauptbestandteil ist Rinderfilet, ein mangels Marmorierung nicht gerade mit Eigengeschmack gesegnetes Stück Fleisch, dass dann prompt noch mit „allem, was gut und teuer ist“ (Blätterteig, Duxelles, in früheren, unerschrockenen Zeiten auch noch Gänseleberpastete) beballert wird, sodass ein Gericht entsteht, das an die Spielweise klassischer Mittelstürmer im Fußball erinnert: es will eher durch Wucht als durch Finesse überzeugen.
Am Anfang meiner kulinarischen Karriere (Ende der 70er) hatte ich auch einmal ein „Wellington“ auf dem Teller. Ich war neugierig auf dieses Gericht gewesen (Siebeck hatte es, glaube ich, mal beschrieben) und da damals ein Restaurantbesuch mit Wellington-Order und Gedöns drumrum (Vorspeise, Dessert, ordentlich Wein) außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten lag, hab ich es selbst zubereitet. Da ich in Sachen Duxelles, Filet und Blätterteig ein Novize war, schob ich eine Art Generalprobe vor und spielte das Gericht mit preiswerteren Produkten schon einmal durch, also eine Art Filet Wellington für Arme bzw. „pour les pauvres“, wie der frankophile Hobbykoch es nannte. Ich briet ein Schweinefilet scharf an und ließ es abkühlen, machte eine Duxelles, indem ich Champignons durch den Fleischwolf drehte1, in einem Küchenhandtuch ausdrückte und mit Schalotten in reichlich Butter briet und als Gänseleber-Ersatz pimpte ich hundsordinäre Kalbsleberwurst mit Weißwein, Creme Fraiche und frischen Kräutern. Diese beiden Pampen strich ich dann auf das Schweinefilet und wickelte die ganze Chose in Blätterteig, den ich mit Eigelb bestrich. Das Gesamtpaket schob ich bei 200 Grad in den Offen, bis der Blätterteig golden aufgegangen war, das hat so ungefähr 25 bis 30 Minuten gedauert, wenn ich mich recht entsinne.
Die Generalprobe klappte hervorragend, und das „richtige“ Wellington, das ich ein paar Tage später zubereitet habe, war dann küchentechnisch auch kein Problem mehr. Trotzdem war ich mit dem Ergebnis nach zwei, drei Bissen nicht wirklich zufrieden. Das war zu klobig, zu klotzig, um wirklich delikat zu sein. Ähnlich ging es vor ein paar Tagen der geschätzten Frau Kaltmamsell, die bei einem Restaurantbesuch mit einem Wellington als Hauptgang ebenfalls nicht ganz glücklich war. Für mich war das Filet Wellington ein kulinarischer Ort, den man einmal aufsucht, um ihn kennenzulernen und anschließend anderswohin fährt, weil’s einem dort besser gefällt. Nicht, dass es mir nicht geschmeckt hätte, im Gegenteil, es war bei mir wohl auch ein Fall von übergroßer Erwartungshaltung.
Hinzu kam, dass mir idiotischerweise das Generalproben-Gericht, dass „Wellington für Arme“ besser gefallen hatte als das Original. Das Schweinefilet mit der Duxelles und der aufgebohrten Leberwurst hatte eine sympathische, direkte Deftigkeit mit Spurenelemente von Delikatesse, das hatte Spaß gemacht. Ich hab dann die „arme“ Version für ein paar Jahre ins Repertoire aufgenommen und gelegentlich für Gäste gekocht. Vielleicht mach ich’s dieser Tage mal wieder. Dann schieb ich ein Foto nach.
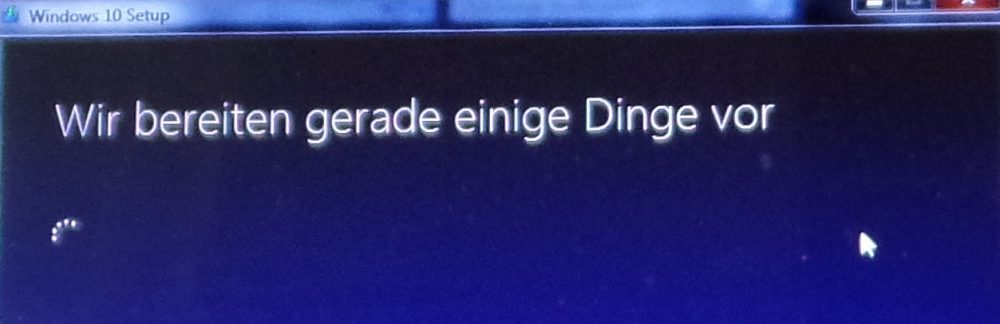
Die Idee mit der gefakten Gänseleber ist schon tollkühn!
Wenn ich das so lese, würde ich die Armeleuteversion auch lieber essen.
Und wenn schon Gänseleber (darf man die noch?) dann mag ich die lieber für sich.
Ich bin, was Nahrungsmittel angeht, relativ schmerzfrei. Ich esse, was die Bauern, die das produzieren, auch essen. Für den, der Stopfleber aus Gewissensgründen nicht essen mag, gibt’s ja mittlerweile auch eine Alternative, da wird normale Gänse- oder Entenleber nachträglich in einem Spezialverfahren mit Fetten angereichert. Ich hab das mal probiert, ich hab keinen Unterschied zu normaler Foie Gras feststellen können. Bin allerdings kein Experte, esse das nur selten. Das einzige, was am Ersatzprodukt stört, ist der Name, „Happy Foie“. Furchtbar.