Dieses Jahr wird es 30 Jahre her sein, dass die Grenze zwischen der BRD und der DDR gefallen ist. Das ist eine ziemlich lange Zeit, und immer öfter höre ich jetzt Menschen erzählen, dass es in der DDR gar nicht so übel war. Okay, das mit der Mauer und dem Schießbefehl und der fehlenden Reisefreiheit und der Stasi war irgendwie doof. Aber immerhin war die DDR antifaschistisch. Und menschliche Wärme wurde da ganz großgeschrieben. Da war nicht alles schlecht in der DDR. Diesen Menschen möchte ich gern von Frau H. erzählen.
1961 lebte Frau H. schon ein paar Jahre lang in Eschwege, einer Kleinstadt in Nordhessen. Geboren war sie in Kella, einem thüringischen Dorf 5 bis 6 Kilometer von Eschwege entfernt. Als Frau H. ihren Mann Fritz geheiratet hatte, war sie nach Eschwege gezogen und hatte ihre Schwester, die in Kella verheiratet war, dort zurückgelassen.
Aber das war ja nicht schlimm. Zwar lag Eschwege jetzt in der BRD und Kella in der DDR, trotzdem war Kella nicht weit weg, irgendwie konnte man sich immer besuchen, die paar Kilometer… Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre begann die DDR dann, Grenzanlagen zu errichten. Zäune, Wachtürme, Minenfelder, Sperrgebiete. Kella war so ein Sperrgebiet. Wer dort wohnte, durfte nicht hinaus. Und wer nicht dort wohnte, bekam keine Besuchserlaubnis. 1961 ging mit der Mauer das letzte Schlupfloch zu. Die Schwestern H. durften sich nicht wiedersehen.
Man nimmt an, dass der Name „Kella“ von Kehle kommt, einer anderen Bezeichnung für Schlucht, denn Kella liegt in einem sehr engen Tal. Oben, auf dem Meinhard, da war Westen. Von dort konnte man runter ins Tal sehen, nach Kella hinein.
Also begann Frau H., sich sonntags auf den Weg zu machen. Sie lief zu Fuß die 2 Kilometer nach Grebendorf und stieg dann weitere 3 bis 4 Kilometer den Meinhard hinauf, bis sie Kella sah. In Kella war am Sonntag keine Menschenseele auf der Straße zu sehen. Die Fenster der kleinen Häuser waren zu, die Läden geschlossen.
Trotzdem begann Frau H. zu winken. Vielleicht konnte ihre Schwester ja doch irgendwie, irgendwann mal nach oben lugen und sie sehen. Sehen, dass sie winkte. Dass ihre Schwester sie nicht vergessen hatte. Dass sie nach wie vor zusammengehörten.
Frau H. ging jeden Sonntag zu diesem Aussichtspunkt auf dem Meinhard. 5 bis 6 Kilometer hin und die gleiche Strecke zurück. Bei jedem Wetter. Und jeden Sonntag winkte sie, mindestens eine halbe Stunde lang. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Bis der Brief kam.
Der Brief von ihrer Schwester aus Kella. Die schrieb, Frau H. möge bitte nicht mehr zum Winken kommen. Sie und ihre Familie hätten mittlerweile ernste Schwierigkeiten wegen der Winkerei. Es wäre besser, wenn das in Zukunft unterbliebe.
Frau H. ist fortan nur noch zwei, drei Mal im Jahr zu dem Aussichtspunkt gegangen und hat nach Kella runtergesehen. Gewunken hat sie nie wieder. Frau H. und ihre Schwester starben, bevor die Grenze 1989 wieder aufging. Sie haben sich nie wiedergesehen.
Das war die DDR. Ein Staat, der Angst vor einer winkenden Frau hatte. Da war nichts Gutes.
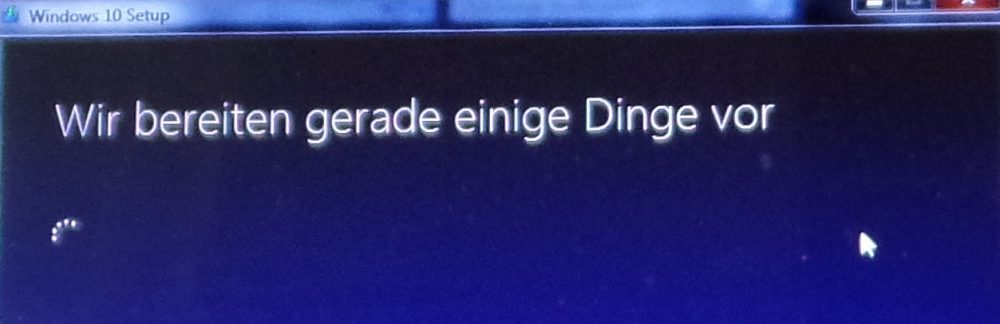
Pingback: Gelesen – Februar 2019 | quarkwasserbecken